Neurodiversität und Neurodivergenz – gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Tatsächlich ja, auch wenn beide Begriffe stellenweise noch immer synonym zum Einsatz kommen. Ich habe selbst eine ganze Zeit lang beide Begriffe immer wieder durcheinandergebracht.
Damit Dir das nicht mehr passiert, kommt jetzt die Erklärung, was hinter den Begriffen neurodivers, neurodivergent und neurotypisch steckt.
Schneller Überblick
Ungeduldig? Kein Problem 😉
Wir fangen einmal mit drei knackigen Definitionen an.
Neurodiversität
Neurodiversität bedeutet, dass jeder Mensch ein einzigartiges Gehirn hat, das sich von anderen unterscheidet. Dieser Begriff umfasst das gesamte Spektrum aller Menschen und steht für die große Vielfalt, die es gibt.
„Neurodivers“ beschreibt also alle Menschen, sowohl neurotypische als auch neurodivergente.
Neurotypisch
Neurotypisch beschreibt das, was gesellschaftlich der Norm entspricht. Natürlich unterscheiden sich auch diese Menschen voneinander, da sie alle Individuen sind. Aber ihre neurologische Entwicklung, ihre Denkweise und ihr Verhalten bewegt sich in dem Bereich, der als „normal“ wahrgenommen wird.
Die meisten Menschen sind neurotypisch.
Neurodivergenz
„Neurodivergenz“ beschreibt Menschen, deren neurologische Entwicklung von der Norm abweicht. Das sind nicht nur ADHSler, sondern zum Beispiel auch Menschen auf dem Autismus Spektrum, mit Legasthenie, Dyskalkulie, Dyspraxie oder dem Tourette-Syndrom.
Neurodivergenz ist keine Diagnose. Psychische Probleme wie zum Beispiel Depressionen, die geheilt werden können, sind keine Neurodivergenz.
Neurodiversität
Jeder Mensch hat ein einzigartiges Gehirn, unterscheidet sich also von allen anderen Menschen. Der Begriff Diversität beschreibt genau diese Vielfalt, und zwar komplett wertneutral. Es steckt also keine Aussage über Stärken und Schwächen darin.
Jeder Mensch gehört in die Kategorie neurodivers. Denn: „Wir sind neurodivers.“ bedeutet nichts anderes als „Wir haben unterschiedliche Gehirne.“
Das Wort Neurodiversität geht auf Judy Singer zurück, die ihn 1997 in ihrer Bachelorarbeit aufbrachte. Sie wollte einen Begriff nutzen, der die wunderbare Vielfalt aller Menschen beschreibt. Die Bezeichnung „Neurodiversität“ ermöglicht es, Abweichungen von der Norm als natürliche Ausprägung der großen Vielfalt wahrzunehmen.
Die Neurodiversitätsbewegung baut genau darauf auf. Statt das, was von der Norm abweicht, als krankhaft, schlechter oder falsch zu betrachten, werden diese Abweichungen zunehmend als natürliche Ausprägung der menschlichen Vielfalt verstanden. Dahinter steckt auch die Erkenntnis, dass es immer von der jeweiligen Situation abhängt, ob eine Eigenschaft ein Vorteil ist oder nicht. Viele ADHSler suchen zum Beispiel Adrenalinkicks und Aufregung – im Bürojob gehen sie schnell zugrunde, aber als Rettungssanitäter oder bei der Feuerwehr können sie ihre Stärken optimal nutzen.
Neurotypisch
Als neurotypisch bezeichnen wir die Menschen, deren neurologische Entwicklung sich in dem Bereich bewegt, der der gesellschaftlichen Norm entspricht. Natürlich unterscheiden sich die Menschen dieser Gruppe voneinander. Sie sind schließlich keine Klone, sondern noch immer Individuen. Aber sie alle befinden sich innerhalb des Normbereichs.
Neurotypisch beschreibt dabei nicht nur das Verhalten von Menschen, sondern ihre Wahrnehmung, ihr Denken und ihr Fühlen. Zum Beispiel:
- Neurotypische Menschen kennen nicht die extremen Formen der Reizüberflutung, die Menschen mit ADHS oder Autismus häufig erleben.
- Sie verstehen nicht die emotionalen und teilweise körperlichen Schmerzen von (gefühlter) Zurückweisung bei ADHSlern.
- Es fällt ihnen deutlich leichter, im zwischenmenschlichen Austausch „zwischen den Zeilen“ zu lesen, während gerade Autisten damit häufiger Schwierigkeiten haben.
Die Welt ist neurotypisch
Probleme entstehen, wenn diese Norm als der einzig „richtige“ Standard betrachtet und jede Abweichung davon ausgebremst wird. In unserer Welt ist das leider überall der Fall. Oftmals ist den neurotypischen Menschen nicht einmal bewusst, wie tiefgreifend das neurodivergente Menschen auf quasi allen Ebenen betrifft.
Schulen sind beispielsweise auf neurotypische Kinder ausgerichtet. Kinder mit ADHS, Autismus oder aber auch Legasthenie und Dyskalkulie haben meist große Schwierigkeiten, sich in den Schulalltag anzupassen. Auch das Berufsleben nimmt selten Rücksicht auf besondere Ansprüche. Hier findet zum Glück ein Umdenken statt, allerdings steht diese Entwicklung noch ganz am Anfang.
Gibt es keine Anpassungen, um ihnen den Alltag zu erleichtern, werden neurodivergente Menschen systematisch benachteiligt. Denn neben der Leistung, die sie in Schule und Beruf erbringen müssen, müssen sie auch noch kontinuierlich ausgleichen, sich in einem falschen Umfeld zu befinden. Dieses Masking kostet enorm viel Energie und bringt eine Reihe von Problemen mit sich:
- Erschöpfung bis hin zum Burnout
- geringes Selbstwertgefühl, da man nur akzeptiert wird, wenn man sich verstellt
- Verlust des „Ich-Gefühls“, da man niemals man selbst ist
- Selbsthass, weil man „falsch“ ist
Neurodivergenz
Als neurodivergent bezeichnen wir die Menschen, die durch ihre neurologische Entwicklung von der Norm abweichen. Dazu gehören wir ADHSler, aber auch Menschen auf dem Autismus Spektrum, mit Legasthenie, Dyskalkulie, Dyspraxie oder dem Tourette-Syndrom.
Neurodivergenz ist also ein Überbegriff für alle Menschen, die auf irgendeine Weise von der neurologischen Norm abweichen. Es ist aber kein klinischer Begriff oder eine Diagnose. Gleichzeitig brauchst Du keine Diagnose, um neurodivergent zu sein.
Wahrscheinlich fallen Dir jetzt gerade diese zwei Dinge auf:
- Neurodivergenz definiert sich darüber, was in der Gesellschaft als neurotypisch gilt. Würde sich die Norm beispielsweise so ändern, dass Menschen mit Autismus als Norm gelten, würden die Menschen als neurodivergent gelten, die sich nicht auf dem Autismus Spektrum befinden.
- Die Grenzen sind fließend. Man kann zum Beispiel nicht immer eindeutig sagen, ob ein Mensch wirklich nur ein bisschen chaotisch und verplant ist, oder ob er eine eher schwach ausgeprägte ADHS hat.
Zur Neurodivergenz gehören keine psychischen Probleme, die durch eine Behandlung geheilt werden können. Eine Depression macht Dich beispielsweise nicht neurodivergent, da sie in der Regel durch Therapie und ggf. Medikamente heilbar ist.
Allerdings sind neurodivergente Menschen häufiger von psychischen Problemen wie Depressionen betroffen.
Ärgerlich: Unsaubere Formulierungen
Obwohl der Unterschied zwischen Divergenz und Diversität klar ist, machen es noch viele falsch. Ärgerlich ist dies bei Websites, die mit ihren Artikeln aufklären wollen und dabei nur noch mehr Verwirrung stiften.
Stellenweise dürfte es an der Suchmaschinenoptimierung liegen: Kommt in einem Artikel über Neurodivergenz oft genug der Begriff Neurodiversität vor (insbesondere in Überschriften), wird er mit dem Suchbegriff „Neurodiversität“ besser bei Google gefunden.
Es passiert aber auch, dass beide Begriffe einfach als gleichwertig genutzt werden. Oder die Definition von Neurodivergenz einfach für die Neurodiversität genommen wird. Das passiert sogar der Tagesschau oder Geo.
Bei solchen Verwechslungen steckt selten eine böse Absicht dahinter, aber das macht die allgemeine Verwirrung kein Stück besser. Denn am Ende suggerieren gerade die Texte solcher großen Plattformen, dass divers und divergent eben doch quasi dasselbe sind.
Neurodiversität als Stärke
Neurodiversität ist für eine Gesellschaft ein enormer Vorteil. Denn gerade dann, wenn verschiedene Sichtweisen zusammenkommen, entstehen die besten Lösungen für Probleme. Und damit meine ich nicht einmal, dass ADHSler als unglaublich kreativ gelten. Schon alleine der Wille, über den Tellerrand zu schauen, hat zahlreiche Vorteile.
Ein schnelles Beispiel: Du sollst ein Team zusammenstellen, das den Stadtpark neugestalten soll, damit er endlich ein beliebtes Naherholungsgebiet wird. Welche Gruppe wird wahrscheinlich das bessere Ergebnis abliefern: Die alteingesessenen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die alle genau wissen, welche Regularien es zu beachten gibt? Oder die Gruppe, in der eine Mutter, ein Rollstuhlfahrer, ein Outdoor Sportler, ein Hundebesitzer, ein Erzieher mit Blick auf die Bedürfnisse von Kindern, ein Rentner, ein Naturschützer und jemand aus der Touristikbranche mitarbeiten?
Du siehst, dass bunt gemischte Teams durch die unterschiedlichen praktischen Lebenserfahrungen zu viel fundierteren Lösungen kommen, die für deutlich mehr Menschen gut funktionieren. Genau deshalb ist es auch für Unternehmen sinnvoll, auf Diversität zu setzen.
Gemeinsam gegen Missverständnisse
Damit die Gesellschaft oder ein Team von einer neurodiversen Vielfalt profitieren kann, müssen alle Seiten Verständnis aufbringen wollen. Das ist kein Job, den nur die eine oder nur die andere Seite erledigen muss. Eine produktive Zusammenarbeit kann nicht funktionieren, wenn die ADHSler verlangen, dass jeder akzeptieren muss, dass sie Deadlines vergessen. Gleichzeitig bringt es nichts, wenn die neurotypischen Kollegen darauf pochen, dass die neurodivergenten Mitarbeiter sich einfach anpassen, damit sich nicht das ganze Unternehmen an eine Minderheit anpassen muss.
Wenn der Abbau von Missverständnissen gelingt, hilft das jedem Einzelnen. Auch neurotypische Menschen profitieren zum Beispiel von reizarmen und ruhigen Büros, die weniger Ablenkung bedeuten. Sauber durchgeplante Projektabläufe sind ebenfalls nicht nur für ADHSler nützlich.
Hast Du eine Eselsbrücke, um Dir den Unterschied zwischen neurodivers und neurodivergent zu merken? Wenn ja, immer her damit – verrate sie mir in den Kommentaren!
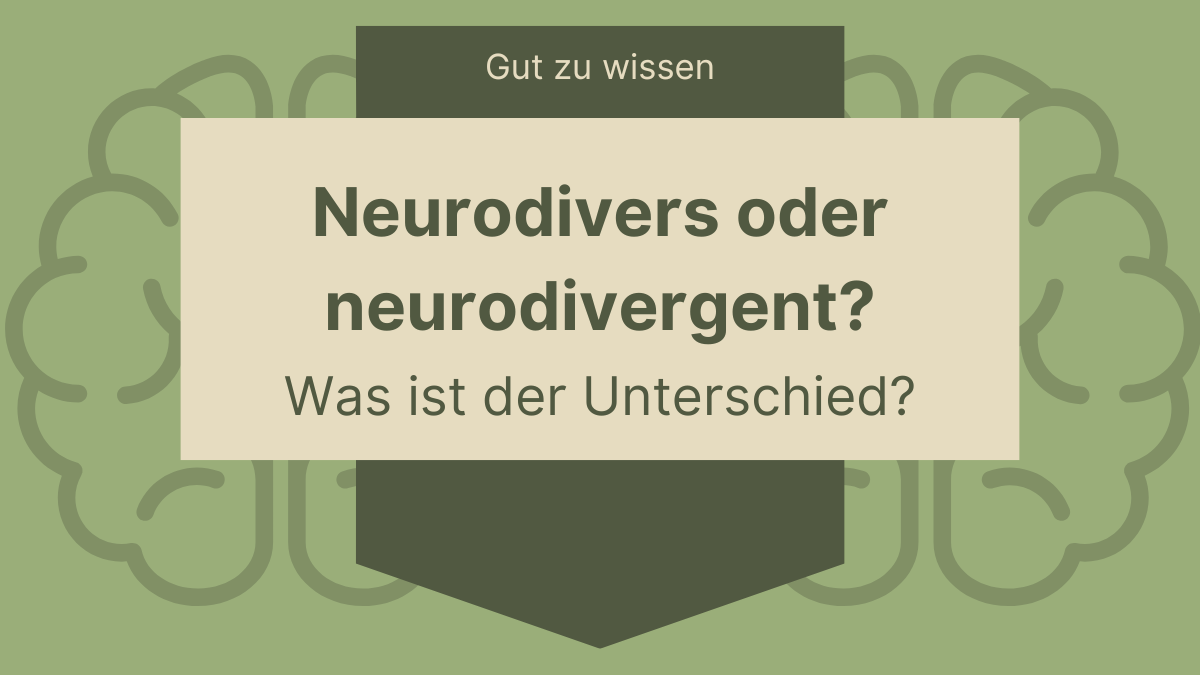
Schreibe einen Kommentar